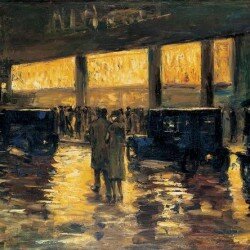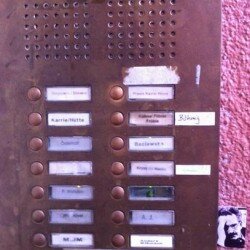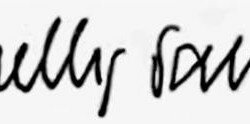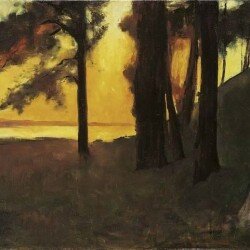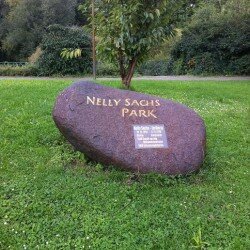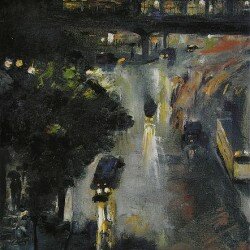Wie alle Terraingesellschaften so war auch die Gmbh „Potsdamer Straße“ nicht auf Dauer angelegt. Ihr Zweck war der Bau und Verkauf, nicht der Unterhalt von Häusern. Bereits 1905 befand sich die GmbH in Liquidation. Die Häuser gingen vorübergehend in das Privateigentum der (mutmaßlichen) Gesellschafter über.
Adolf Gradenwitz und seine Frau zogen allein in eine Wohnung am Landwehrkanal; die Töchter und Söhne hatten ihre Familien gegründet. Die Baugesellschaft wurde um 1910 aus dem Handelsregister gelöscht. Sie hatte ihre Aufgaben erfüllt. Geschaffen war eine hochklassige Wohnlage, im Besitz von bekannten Namen der Berliner Gesellschaft. Den Gründern dürft sie eine ausreichende Rendite beschert haben.(92)
So enden acht spannende Seiten in dem Buch „Die Schwarzen Schafe bei den Gradenwitz und Kuczynski“, auf denen Hans Hinrich Lembke, Hochschullehrer für Betriebswirtschaft und Verfasser mehrerer unernehmenshistorischer Arbeiten, die Entwicklung eines Teils der Potsdamer Straße an einer Jahrhundertwende beschreibt.
Wer war Adolf Gradenwitz und um welche Straße handelt es sich?
Adolf Gradenwitz, 1841 geboren, war Bankier, zunächst Direktor der Niederlausitzer Bank AG in Cottbus. Nach deren Liquidation zog der 1889 nach Berlin in einen Neubau in der Rathenowerstraße, den er 1886 erworben hatte. Seine Berufsbezeichnung war zunächst Kaufmann, später Rentier. Nach sechs Jahren verkaufte er das Haus und zog mit der Familie in die Lessingstraße. Außerdem entschloss er sich zur Karriere des Immoblienkaufmannes – im damaligen Sprachgebrauch „Terrainspekulant“. … Die erste große Investition tätigte er in dem Karree zwischen Potsdamer Straße, Lützowstraße und Am Karlsbad (85).
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass das minutiös recherchierte Buch ungemein interessante Fußnoten enthält. So zum Beipiel Fußnote 263, die Auskunft gibt über den Verkehrszustand der Potsdamer Straße zu dieser Zeit: „Verkehrszählungen aus dem Januar dieses Jahres haben ergeben, daß die Potsdamer Straße an einem Tage während der Zeit von 6 Uhr morgens bis zwölf Uhr nachts rd. 8700 Fahrzeuge passieren.“ Diese Erkenntnis gab noch im selben Jahre (1897) den Anstoß für eine Verbreiterung der Straße, die zuvor zwischen Lützowstraße und Potsdamer Platz nur eine Dammbreite von 11 – 12 Meter hatte. Deutsche Bauzeitung, 31 (1897) 43, S. 269
Die Potsdamer Straße selbst war zu dieser Zeit bereits dicht bebaut. Hier fanden wohlhabende Bürger keine ruhigen Wohnbedingungen mehr und zogen eher weiter nach Westen. Wenn sie blieben, dann in Privatstraßen, die heute zum Teil noch erhalten sind.

So residierten Am Karlsbad der Maler Carl Begas der Ätlere seit den 1830er Jahren. Sein Sohn Reinhold, ebenfalls Maler und die Bildhauer Friedrich Drake und August Wredow waren ihm gefolgt.
Im sogenannten „Begaswinkel“ ( = zu erreichen von der Genthiner Straße) ließ sich der andere Sohn, Adalbert Begas, nieder. Derselbe Architekt, der diese – noch erhaltenen Villen – baute, also Ernst Klingenberg, baute dann eine Gruppe von sechs Hofvillen auf dem Gelände, das wir heute noch gerne Ex-Tagesspiegel nennen, obwohl es schon längst nur noch drei Villen hat und auch andere Besitzer. Dort lebten und arbeiteten u.a. der Akademiepräsident Anton von Werner und der Kunsthändler Fritz Gurlitt. Diese Villen wurden vom Lärm der Straße durch das Quergebäude Nr. 133 abgeschirmt.
Durch diese Ausgangslage spazierte Adolf Gradenwitz im Jahr 1895. Er wird um die vielen Künstler gewusst haben, deren Anwesenheit das Viertel aufwerten. Um die Königliche Kunsthochschule für Musik, die seit 1883 im Haus Nr. 120 gezogen war und wo u.a. Friedrich Kiel unterrichtete, der in der Lützowstraße 92 wohnte. Auf der anderen Seite hatten die Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen aus Anlass ihres 25-jährigen Bestehens eine neue Mal- und Zeichenschule eröffnet ( = heute Camaro-Stiftung) . Es gab Privatschulen, Ateliers, Kunsthandlungen und Geschäfte für Künstlerbedarfe.

Allein den Villenwinkel in der heutigen Bissingzeile gab es noch nicht. Hierzu Lemke: Die Idee, dieses Potential für den Bau eines „Villen-Winkels“ zu nutzen, hatte vermutlich nicht Gradenwitz, sondern vor ihm ein anderer Bauunternehmer entwickelt. Ein Baugeschäft Garnn & Krantz kaufte zwischen 1892 und 1895 die beiden Häuser 121 und 122 (alte Zählung), die schon an der Einmündung der Privatstraße erbaut waren. Die Pläne zur Entwicklung dieser Straße tragen die Namen Garnn & Krantz (für die Grundrisse) sowie Cremer & Wolffenstein (für die Fassaden). Ein dritter Name findet sich erstmals 1896 im Adressbuch: Eine „Potsdamer Straße Baugesellschaft GmbH“ ist als Eigentümerin der beiden Grundstücke genannt (laut Fußnote 267 waren sie ab 1896 nicht mehr eingetragen). Die Firma war im Vorjahr ins Handelsregister eingetragen worden, mit dem „Rentier“ Adolf Gradenwitz als allein vertretungsberechtigtem Geschäftsführer. (86)
Laut Berliner Börsen-Zeitung Nr. 276 vom 15. Juni 1895 (Fußnote 269) war der benannte Unternehmenszweck die Errichtung von Gebäuden und der Verkauf der Gebäude und Grundstücke. Das Stammkapital belief sich auf 1 Million, ein Hypothekendarlehen auf 4,5 Millionen Mark.
Gesellschafter der GmbH sind laut Lemke nicht bekannt und er stellt Überlegungen an inwieweit Gradenwitz vielleicht doch mit Garnn & Krantz kooperierte oder konkurrierte. Im Zusammenhang mit der Frage nach Konkurrenz oder Kooperation (s.o.) ist bemerkenswert, dass bei Auflösung der Baugesellschaft sowohl ein Baumeister Garnn als auch eine Frau Garrn Hauseigentümer in dem Straßenwinkel wurden – für nur wenige Jahre. Auffällig ist auch, dass Gradenwitz‘ zweite Gesellschaft, die Zehlendorf-West Terrain AG kurzzeitig die Potsdamer Straße 6 (alte Zählung) als Adresse auswies, wo vorher der Baumeister Garnn gewohnt hatte. Möglicherweise wurde er für diese Gesellschaft tätig – Konkurrenz oder Kooperation? (Fußnote 272)
Die zwölf vierstöckigen Mietshäuser mit mehreren Wohneinheiten wurden gebaut vom Architektenbüro Cremer & Wolffenstein, die zeitgleich auch die 1898 in der Lützowstraße eingeweihte Synagoge errichteten. Die zwei bereits bestehenden Häuser wurden umgebaut und ebenfalls in das Ensemble integriert. Das Projekt wurde in einem Artikel „Berliner Wohnbaublöcke“ als ein vornehmes Beispiel mit herrschaftlichen Mietwohnungen“ beschrieben. (Fußnote 274)

Und auf Seite 203f im dritten Band von „Berlin und seine Bauten“ wurden die Privatstraße im Bereich der Potsdamer Straße nicht nur ausführlich beschrieben, sondern die Verfasser resümierten: Wohnungen in derart gelegenen Häusern pflegen wegen der Ruhe, die sie bieten, sehr gesucht zu sein. (Fußnote 274)

So mußte auch Adolf Gradenwitz nicht lange auf Mieter warten. Sie kamen aus dem gehobenen Bürgertum, nur wenige Industrielle mieteten sich ein. Bankbeamte hingegen kamen viele. Die Immobilienbranche war vertreten, etwas Kunstgewerbe, eine damals noch unbekannte Kunsthandlung und der Mitinhaber eines alteingeesessenen Kunsthauses. Ein Jurist und zwei Architekten. Ein Professor für Malerei und eine Malerin nahmen ebenfalls Quartier. Und auch die links-bürgerliche Intelligenz fand ein zu Hause.
Terraingesellschaften und Architekten gehörten zum Berufsmilieu des Adolf Gradenwitz, Künstler zur Zukunftswelt seiner älteren Tochter. Als die Familie in den Villen-Winkel zog, war Berta Gradenwitz 18 Jahre alt. Über ihre Ausbildung ist wenig bekannt; in den Erinnerungen ihres Sohnes war sie ein (nicht überragend) begabte Malerin. ….. Zu vermuten ist auch, dass sie dort [im Haus des Künstlerinnenvereins in der Potsdamer Straße] eine Zeitlang Schülerin war. (89)
Als das Werk vollendet war, wandte sich Adolf Gradenwitz endgültig der Region um den Schlachtensee zu, den er schon seit 1894 im Auge hatte.

Und die Straße? Fußnote 268: Die „Potsdamer Privatstraße“ (inoffizieller Name) wurde 1936 nach einem General Bissing benannt („Bissingzeile“). Bissing war im 1. Weltkrieg der deutsche Generalgouverneur in Belgien; er zielte auf eine Angliederung der flämischen Gebiete an das Deutsche Reich. Erst 1955 wurde die Zeile zur öffentlichen Straße; die Benennung blieb unverändert.






 Der Gedenkstein für Klaus Jürgen Rattay wurde spontan als direkte Reaktion auf den Tod des Hausbesetzers verlegt und ist gleichzeitig politischer Protest. Auch wenn nicht genau klar ist, wer den Stein angebracht hat, lassen sich ein paar allgemeine Aussagen darüber treffen.
Der Gedenkstein für Klaus Jürgen Rattay wurde spontan als direkte Reaktion auf den Tod des Hausbesetzers verlegt und ist gleichzeitig politischer Protest. Auch wenn nicht genau klar ist, wer den Stein angebracht hat, lassen sich ein paar allgemeine Aussagen darüber treffen.